Ganz normal & doch ganz besonders

„Männer sollen an jedem Ort beten, dürfen sich in den Zusammenkünften der Gläubigen beteiligen, öffentlich das Wort verkündigen … und ich? Wie kann ich als Schwester dem Herrn dienen?“
Diese und ähnliche Fragen sind wahrscheinlich fast genauso alt wie die Geschichte der Christenheit. Dabei finden wir in Gottes Wort, dass Gott auch für Schwestern ein reiches Betätigungsfeld mit vielfältigen Aufgaben hat. In Apostelgeschichte 9,36-43 lesen wir von Tabitha. Sie ist ein Mut machendes Beispiel – und das nicht nur für Schwestern, sondern auch für Brüder, die meinen, Gott habe ihnen keine besonderen Fähigkeiten für einen Dienst gegeben.
Nur eine arme Schneiderin?
Tabitha war Schneiderin. Damals wie heute kein Beruf zum Reichwerden und auch kein Beruf im Rampenlicht des öffentlichen Interesses. Trotzdem war Tabitha alles andere als eine arme Schneiderin. Denn ein gut gefülltes Bankkonto ist nicht der alleinige Maßstab für Reichtum. Was Gottes Wort über diese Frau berichtet, führt uns das eindrücklich vor Augen.
Eine einmalige Frau
Die Schrift berichtet häufig von Männern, die Jünger genannt werden, wie die Jünger, die Johannes dem Täufer folgten, oder die Jünger des Herrn Jesus. Aber eine Jüngerin? Tabitha ist die einzige Frau in der Bibel, die so genannt wird.[1] Das ist tatsächlich etwas Besonderes!
Jünger(innen) sind Menschen, die alles von ihrem Herrn lernen wollen. Sie möchten das gehorsam tun, was ihr Lehrer ihnen sagt und Ihm nachfolgen. So stand Tabitha zum Herrn Jesus, ihrem Meister.
Eine Frau, die ihrem Namen Ehre macht
Der Name Tabitha stammt aus dem Aramäischen. Die Bibel nennt uns auch die griechische Übersetzung: „Dorkas“. Im Deutschen bedeutet er „Gazelle“.
Gazellen sind flink und ausdauernd, dazu geschickte Kletterer in felsiger Umgebung. Vielleicht ist ihr Name ein Hinweis darauf, wie Tabitha arbeitete. Denn nicht nur in Joppe gab es damals viele hilfsbedürftige Menschen. Wenn sie die benötigten Unterkleider und Gewänder immer zur rechten Zeit fertig haben wollte, musste Tabitha schnell und geschickt mit der Nähnadel umgehen können und ihre Arbeit zügig erledigen.
Dass ihr Name so betont wird, dass er sowohl in aramäischer als auch griechischer Sprache genannt wird, hat jedem etwas zu sagen, der den Herrn Jesus Christus im Glauben angenommen hat – werden wir doch in Anlehnung an den Namen des Herrn „Christen“ genannt (s. Apg 11,26). Welche Ehre machen wir diesem Namen?
Eine Täterin des Wortes
„Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte“ (V. 36). Tabitha verwirklichte, was der Apostel Johannes viele Jahre später schrieb: „Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit“ (1. Joh 3,18). Diese Aufforderung ist auch für uns heute noch gültig!
Gott hat jeden von uns mit einer Fähigkeit ausgestattet, die wir nutzen können, um anderen eine Freude zu bereiten. Egal, ob wir gut kochen oder backen, schön singen, geduldig zuhören oder geschickt mit Werkzeug umgehen können. Es gibt immer Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Darum lasst uns einfach die Aufgaben anpacken, die der Herr uns direkt vor die Füße legt.
Es kann anstrengend sein, anderen zu helfen, aber es bereitet auch Freude. Dabei dürfen wir sicher sein, dass der Herr uns die nötige Kraft und Weisheit für die Aufgaben schenken wird, die Er uns aufträgt und die wir darum zu seiner Ehre erfüllen möchten.
Wir lesen nichts davon, dass Tabitha extra danach gefragt hat, was sie für den Herrn tun könnte. Sie machte „einfach“ das mit ganzem Herzen für Ihn, was anlag.
Eine Frau, die reichlich säte
Tabitha besaß einen Reichtum, den ihr niemand stehlen konnte und den Gottes Wort ausdrücklich betont: Sie war „reich an guten Werken und Almosen, die sie übte“ (V. 36b).
Wie kam das? Woher nahm sie die Kraft für diesen Einsatz, den viele damals wohl kaum beachtet haben, noch für lohnenswert gehalten haben werden?
Als Jüngerin folgte sie dem Beispiel ihres Herrn. Sie war erfüllt von der Liebe des Herrn Jesus. Weil ihr Herr und Heiland sie so lieb hatte, dass Er für ihre Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben war, konnte sie von dieser Liebe weitergeben und für Ihn arbeiten. Weil der Herr Tabitha so viel geschenkt hatte, konnte sie auch anderen etwas geben.
„Einen fröhlichen Geber liebt Gott“
Eine Frau, die reichlich erntete
Der Bericht in der Bibel über diese Frau zeigt uns die ganze Wertschätzung, die für sie und ihre Arbeit vorhanden war! Als Tabitha starb, waren viele Glaubensgeschwister traurig. Sie spürten die entstandene Lücke. Wer sollte sie schließen?
In ihrer Not sandten sie zwei Männer als Boten zu Petrus, der gerade in der Nachbarstadt war, und baten ihn, nach Joppe zu kommen (s. V. 38). Weinend zeigten die Witwen, die Tabithas tätige Liebe erfahren hatten, dem Apostel die Unterkleider und Gewänder, die Tabitha für sie genäht hatte.
Sie stellten der Gestorbenen damit ein eindrucksvolles Zeugnis aus. Das trieb Petrus ins Gebet. Der Herr antwortete darauf und schenkte in seiner Gnade daraufhin, dass Tabitha den Gläubigen noch einmal wiedergegeben wurde.
Für viele Menschen in Joppe wurde gerade dieses Wunder ihrer Auferweckung der Anlass dafür, an den Herrn Jesus zu glauben. So wertvoll war der Dienst dieser Frau in den Augen Gottes!
Stefan Busch
Ein häufiges Missverständnis
Wie kommt es, dass viele Christen den Eindruck haben, nichts für den Herrn tun zu können? Dieser Gedanke kann zum Beispiel entstehen, wenn wir falsche Vorstellungen von „Dienst für den Herrn“ haben und darunter nur Missionare oder Christen im sogenannten „vollzeitlichen Einsatz“ für den Herrn verstehen. Oder es werden nur solche Aufgaben als Dienst angesehen, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
Dabei sagt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Kolosser in Kapitel 3,23: „Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen.“ Wäsche bügeln, den Kindern bei Schulaufgaben helfen, mit denen sie nicht zurechtkommen, der alten Frau von nebenan den Wasserhahn reparieren, im Beruf und im Haushalt seine Aufgaben ordentlich erledigen … Dienst für den Herrn beschränkt sich eben nicht nur auf die Ausübung besonderer geistlicher Gaben in einem eng umrissenen Tätigkeitsgebiet. Wir sollen und dürfen ausnahmslos alles für unseren Herrn tun – mit voller Überzeugung und von ganzem Herzen (s. Kol 3,23). Das wird uns auch vor Unzufriedenheit mit den uns anvertrauten Aufgaben bewahren.
Fußnoten:
Es gibt eine Reihe von Bibelstellen, in denen Jünger erwähnt werden, und der Zusammenhang macht deutlich, dass sowohl Männer als auch Frauen eingeschlossen sind (z.B. Mt 12,49; Apg 9,1.2.19; 11,26). Aber nur Tabitha wird namentlich als Jüngerin vorgestellt.
3 wichtige Gewissheiten (Gedanken zu 1. Johannes 5)

Der Apostel Johannes ist in seinem ersten Brief besonders darum bemüht, die Gläubigen ihrer Vorrechte und Segnungen zu vergewissern. Wie wichtig ist das auch heute für uns.
Während es im Johannes-Evangelium um die Darstellung des Sohnes Gottes geht, hat der 1. Johannesbrief vornehmlich die Söhne Gottes zum Thema. In den ersten beiden Kapiteln dieses Briefes wird das Leben der Kinder Gottes, die als Söhne (und Töchter) die Familie Gottes bilden, mit dem Vater beschrieben. Ab Kapitel 3 wird dann das Leben der Söhne Gottes vor der Welt vorgestellt.
Im Verlauf des Briefes fällt auf, dass der Apostel Johannes immer häufiger das Wort „wissen“ gebraucht. Allein im 5. Kapitel kommt es sieben Mal vor. Gott möchte, dass bei seinen Kindern das Bewusstsein ihrer Sicherheit und ihre Gewissheit über das ganze Glaubensgut stetig wächst. Kommen wir nun zu den drei Gewissheiten.
Gewissheit im Glauben
Zuerst wird unsere innige Beziehung zum Herrn Jesus hervorgehoben: „Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes“ (1. Joh 5,13). Wir glauben an seinen Namen, d. h. an die ganze Offenbarung des Herrn Jesus in der Heiligen Schrift als Sohn Gottes, was weit mehr ist, als allein an sein Sterben auf Golgatha zu glauben. Es umfasst alle Wahrheiten und Segnungen, die wir in Christus haben und auch praktisch genießen können, weil wir als Kinder Gottes ewiges Leben und damit eine lebendige Beziehung zu Ihm haben. Diese Gewissheit, dass wir unzertrennlich mit Christus verbunden sind, soll auch heute bei jedem einzelnen Schritt im Glaubensleben vermehrt zur Auswirkung kommen.
Gewissheit im Gebet
Dann greift der Apostel eine weitere praktische Tatsache auf: die Gewissheit, dass Gott uns hört. „Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgend wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben“ (1. Joh 5,14).
Gott möchte, dass seine Kinder auch über die Auswirkungen der Gebete absolut sicher sind. So haben wir die Gewissheit, dass Er uns hört, um was irgend wir bitten – weil wir ebenso wissen, dass unsere Bitten schon erhört worden sind, als wir sie von Ihm erbeten haben. Das wiederum wissen wir, weil wir gemäß seinem Willen gebetet haben. Wir wissen allerdings nicht, wann und wie die Bitten beantwortet werden – aber sie sind erhört! Dieses Vertrauen in Gottes Weisheit und Allmacht soll durch unsere Gebete mit wachsender Gewissheit zum Ausdruck kommen.
Dabei ist es schön zu sehen, wie auch im Verlauf unseres Briefes diese Gewissheit dahingehend zunimmt. So ist zwar schon in Kapitel 3 das Bewusstsein angedeutet, dass Gott unsere Bitten hört und wir dementsprechend empfangen („und was irgend wir erbitten, empfangen wir von ihm“ (1. Joh 3,22)), doch die gleiche Tatsache wird hier nun mit vermehrter Gewissheit ausgedrückt: „Wir wissen, dass er uns hört, um was irgend wir bitten“ (1. Joh 5,15). So soll auch in unserem Leben die Gewissheit, dass wir alles von Gott erwarten können, zunehmen, um sichere Schritte tun zu können. Der Feind möchte genau das Gegenteil bewirken und unseren Gang durch Zweifel unsicher machen.
Gewissheit bezüglich unserer Stellung
Um diesem Bestreben des Teufels gewissermaßen zuvorzukommen, kommt der Apostel in den weiteren Versen des 5. Kapitels zum Höhepunkt des gesamten Briefes, dem dreifachen „wir wissen“ im Hinblick auf unsere naturgemäße Stellung vor Gott und der Welt.
- „Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich, und der Böse tastet ihn nicht an“ (1. Joh 5,18). Hier geht es um die Wesensart unserer neuen Natur. Wir sündigen nicht, weil wir aus Gott geboren sind (s. 1. Joh 3,9) und deshalb die Gemeinschaft mit Gott suchen und darin bleiben. Und so kann uns der Teufel nicht antasten. Der Feind kann uns zwar nicht aus der Hand Gottes rauben, aber wohl noch verunsichern oder verletzen, indem er Zweifel an der Liebe Gottes aufkommen lässt und die Gemeinschaft mit Gott stört. Wie wichtig, dann sagen zu können: „wir wissen“!
- „Wir wissen, dass wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in dem Bösen“ (1. Joh 5,19). Hierbei geht es nun um den Ursprung unserer neuen Natur. Wir sind aus Gott. Im Gegensatz dazu liegt die Welt, d. h. die Welt der ungläubigen Menschen, in dem Bösen, ihr Vater ist der Teufel (s. Joh 8,44). Welch ein Glück, zu wissen, dass wir mit der gottlosen Welt nichts mehr zu tun haben.
- „Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist …“ (1. Joh 5,20). Jetzt kommt der Gegenstand oder der Lebensinhalt unserer neuen Natur vor unsere Blicke – es ist Christus selbst, der „… uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus“ (1. Joh 5,20). Großartig, zu wissen, dass wir nicht nur Gott erkennen, nicht nur aus Ihm sind, sondern auch in Ihm, d. h. untrennbar mit Ihm verbunden – und zwar indem wir in seinem Sohn, dem Herrn Jesus, sind!
Sind diese wenigen Verse aus dem 1. Johannesbrief nicht dazu angetan, unsere Gewissheit über alles, was wir in und durch Christus haben, in jeder Hinsicht zu stärken und zu vermehren? Wie wichtig ist es, Herzensgewissheit im Glauben zu haben, damit der Feind uns nicht antasten kann!
Matthias Wölfinger
Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf dem neuen und lebendigen Weg …
und einen großen Priester haben über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens …
Wie wird es im Himmel sein? (Teil 7)
Der ewige Zustand

Die Frage, wie es im Himmel sein wird, hat uns sicher alle schon beschäftigt. Auch Kinder fragen danach. Antworten darauf zu geben, fällt uns manchmal gar nicht so leicht. Dem, was uns Gottes Wort dazu sagt, gehen wir in dieser Artikelserie ein wenig nach.
„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen: Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein noch Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen“
In diesen Versen bekommen wir einen Einblick in den ewigen Zustand. Die Bibel sagt nicht viel darüber, aber was sie sagt, reicht völlig aus, um unsere Herzen zu beglücken. Gott hatte einst Himmel und Erde geschaffen und die ganze Schöpfung war „sehr gut“ (1. Mo 1,31) aus seiner Hand hervorgegangen. Der Mensch hat sie unter dem Einfluss des Teufels völlig verdorben. Die Schöpfung seufzt bis heute unter diesem Zustand.
Während des 1000-jährigen Reiches wird Gott noch einmal Aufblühen schenken unter einer Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit. Aber sobald der Teufel wieder losgelassen werden wird, wird er die Menschen erneut zum Widerstand gegen Gott verführen.
Dann wird Gott in einem endgültigen Gericht eingreifen und dem ersten Himmel und der ersten Erde ein Ende bereiten. Nach 2. Petrus 3,12 werden Himmel und Erde in Feuer geraten und aufgelöst werden und alle Elemente im Brand zerschmelzen.
Wie viel Geduld hat Gott dieser gefallenen Erde gegenüber gezeigt. Er hat sogar seinen einzigen Sohn auf diesen winzigen Planeten gesandt, damit Er durch sein Leiden und Sterben die Sünde der Welt wegnehme (s. Joh 1,29). Wie lange hat Gott schon seine Gnade erwiesen?!
Aber einmal wird die Weltenuhr endgültig abgelaufen sein. Gott wird diese Welt nicht reparieren, sondern etwas völlig Neues schaffen: einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir wollen uns einige Punkte dieser neuen Schöpfung anschauen:
- Das Meer ist nicht mehr. Das Meer bedeutet Trennung, Unbekanntes, Unruhe, Tiefen und Gefahr. Auch wühlt es Schmutz auf (s. Jes 57,20). Das alles wird nicht mehr sein.
- Das neue Jerusalem (die Versammlung) wird aus dem Himmel herabkommen. Auf der neuen Erde werden alle Erlösten wohnen. Sie werden nicht weiter unterschieden, dennoch wird die Versammlung einen besonderen Platz haben. Der eigentliche Wohnort derer, die zu der Versammlung gehören, wird das Haus des Vaters sein. Aber Gott wird durch die Versammlung bei den Menschen auf der neuen Erde wohnen. Mit unserem begrenzten Verstand können wir uns nicht wirklich vorstellen, wie das sein wird. Deswegen fasst sich Gottes Wort hier auch so kurz und zeigt uns vor allem, was nicht mehr sein wird, weil das an unseren Erfahrungshorizont anknüpft.
- Die Versammlung wird hier bezeichnet als „eine für ihren Mann geschmückte Braut“. Die Beziehungen der Liebe zwischen Christus und seiner Versammlung werden in alle Ewigkeit frisch und herrlich sein. Und die Versammlung wird ihrem Bestimmungszweck völlig gerecht – sie wird für Ihn geschmückt sein, zu seiner Verherrlichung.
- Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wie viele Tränen werden täglich auf dieser Erde geweint. Wie oft befinden wir uns im Tränental. Aber dann wird Gott die letzte Träne abwischen – für immer.
- Der Tod wird nicht mehr sein. Der Tod ist eine unmittelbare Folge des Sündenfalls und bringt jedes Mal Not und Leid mit sich. Unvorstellbar herrlich, wenn er endgültig weggetan sein wird (s. a. Off 20,14)!
- Trauer wird nicht mehr sein. Der Tod bringt Trauer mit sich, wenn einer der geliebten Angehörigen oder Freunde abgerufen wird. Aber auch viele andere Umstände im Leben können zu Traurigkeit führen. Was wird es sein, wenn von Trauer keine Spur mehr sein wird!
- Geschrei wird nicht mehr sein. Wie viel Geschrei gibt es in dieser Welt! Notvolles Geschrei über Ungerechtigkeit und Leid, aber auch böses Geschrei aus Wut und Hass. Dann werden sich alle Wellen für immer gelegt haben und eine ewige Ruhe wird anbrechen.
- Schmerz wird nicht mehr sein. Diese Erde ist voll von Schmerz: Schmerz aufgrund körperlicher Leiden und Gebrechen, seelischer Schmerz, Trennungsschmerz usw. Unvorstellbar herrlich wird es sein, wenn er für immer verschwunden sein wird.
Wie gut, dass wir Gläubigen der Jetztzeit nicht erst warten müssen, bis der ewige Zustand anbricht! Sobald der Herr uns bei der Entrückung zu sich geholt hat, werden wir in den Genuss all dieser Segnungen kommen. Im Himmel werden wir eine vollkommene Glückseligkeit erleben. Mittelpunkt wird unser anbetungswürdiger Herr sein, der uns so liebt!
Damit beenden wir nun diese Serie über den Himmel. Es ist mein Wunsch und Gebet, dass alle Leser dadurch ermuntert werden konnten und dass die Vorfreude neu angefacht wurde.
Andreas Kringe
Wie es von Anfang an war
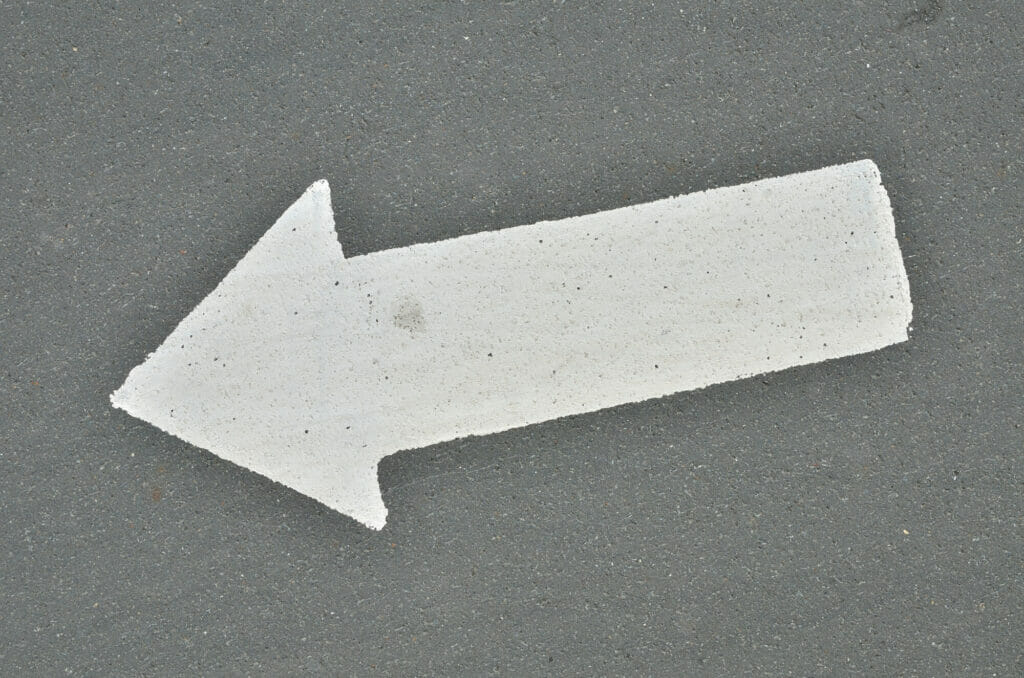
Manchmal ist es gut, an den Anfang zurückzugehen. Um zu erkennen, wie es ursprünglich war. Das wollen wir in diesem Artikel tun. Wir gehen an den Anfang der Geschichte des Menschen zurück, lesen 1. Mose 1,26-31 und fragen uns, was der Schöpfer von Beginn an für den Menschen im Sinn hatte. Das gibt uns Orientierung in einer Zeit, in der die Menschen sich immer weiter von Gottes Gedanken entfernen.
Ein feierlicher Austausch im Himmel
Bevor die Bibel die Erschaffung des Menschen schildert, beschreibt Gottes Wort einen feierlichen Austausch im Himmel. Gott sprach: „Lasst uns Menschen machen“ (1. Mo 1,26). Dass es Menschen geben sollte, war im Himmel schon lange vor der Erschaffung der Welt ein Thema (s. Spr 8,31). Dem Menschen galt das besondere Interesse Gottes und das ist bis heute so geblieben.
Bild und Gleichnis
Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bild und in seinem Gleichnis. Bei einem Bild geht es darum, dass die Wirklichkeit gezeigt wird. So ist es der Plan Gottes, dass der Mensch etwas von Gott zeigt, denn er ist im Bild Gottes geschaffen. An dieser Bestimmung Gottes für den Menschen hat sich auch durch den Sündenfall nichts geändert. Bis heute ist es der Gedanke Gottes, dass der Mensch sein Bild ist (s. 1. Kor 11,7).
Das spornt uns an, uns so zu verhalten, wie Gott sich verhalten würde. Als wiedergeborene Christen haben wir das neue Leben und den Heiligen Geist. Deshalb haben wir sowohl die Fähigkeit als auch die Kraft, uns so zu verhalten, dass Gottes Bild in uns gesehen wird.
Der Mensch war auch im Gleichnis Gottes geschaffen. Gott ist heilig und völlig ohne Sünde. Und Er hat den Menschen in Unschuld geschaffen. Das ist nicht dasselbe, denn der Mensch war in der Lage, zu sündigen, was bei Gott keineswegs möglich ist. Aber es ist ein Aspekt dessen, dass der Mensch im Gleichnis Gottes geschaffen wurde. Leider ist das durch den Sündenfall verloren gegangen.
Mann und Frau
Ein weiterer Gedanke Gottes bei der Erschaffung des Menschen war, ihn als Mann und als Frau zu erschaffen. So hat Er es dann auch getan, wie uns in 1. Mose 2 im Detail beschrieben wird. Der Mann ist als Mann geschaffen, die Frau ist als Frau geschaffen. Etwas „dazwischen“ gibt es nicht. Der Mensch, Mann und Frau, ist aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen und „es war sehr gut“ (1. Mo 1,31).
Bis heute hat sich nichts an dem geändert, was der Schöpfer einmal sehr gut geschaffen hat (s. Mt 19,4). Und es ist ein Segen, genau so zu leben, wie es dem entspricht, was Gott gemacht hat.
Fruchtbarkeit
Mit der Erschaffung von Mann und Frau hat Gott den Auftrag verbunden, fruchtbar zu sein und sich auf der Erde zu mehren (s. 1. Mo 1,28). Das macht deutlich, dass Gott den Gedanken der Ehe in seine Schöpfung gelegt hat, der Ehe des einen Mannes mit der einen Frau. So erklärt Gott es dann auch in 1. Mose 2,24: „Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein.“ Eine Ehe, die einmal geschlossen ist, soll nicht wieder geschieden werden. Auch in Verbindung damit weist der Herr Jesus darauf hin, dass das Gottes Absicht „von Anfang an“ war (s. Mt 19,5-8).
Bis heute ist es Gottes Gedanke, dass ein Mann und eine Frau heiraten und Kinder bekommen. Dabei ist uns klar, dass es für uns als wiedergeborene Christen ein Heiraten „im Herrn“ (1. Kor 7,39) sein muss.
Natürlich gibt es Ausnahmen von diesem grundsätzlichen Weg. Es mag sein, dass jemand die Gnadengabe hat, allein zu bleiben, um ganz für den Herrn zur Verfügung zu stehen. Es mag auch andere Gründe geben und es gibt durchaus auch die Situation, dass jemand gerne heiraten möchte (oder dass sich Verheiratete Kinder wünschen) und es öffnet sich keine Tür dafür. Aber grundsätzlich bleibt es Gottes Absicht, dass Ehen gegründet und Kinder geboren werden.
Die Schöpfung untertan machen
Daneben hat Gott dem Menschen die Verantwortung übertragen, die Schöpfung gut zu verwalten. Dafür sollte er sich die Erde und auch die Tiere untertan machen. Es ist selbstverständlich, dass es Gottes Wunsch ist, dass der Mensch die Schöpfung sorgfältig behandelt und auch in seinem Verhalten den Tieren gegenüber im Sinn Gottes auftritt. Niemals wäre es im Sinn des Schöpfers, wenn Tiere gequält würden.
Und doch steht der Mensch über dem Tier, das Wohl des Menschen geht über das Wohl des Tieres. Später hat Gott dem Menschen sogar die Tiere zur Nahrung gegeben (s. 1. Mo 9,3). Nicht das Tier sollte über den Menschen herrschen, sondern der Mensch über das Tier.
Nahrung
Für alle Aufgaben, die Gott dem Menschen gegeben hat, benötigt er auch Nahrung, die ihm Kraft gibt. Auch dafür hat Gott Vorsorge getroffen. Zunächst hat Er dem Menschen alles samenbringende Kraut und die samenbringenden Früchte gegeben. Er hat dabei eine große Vielfalt für den Menschen zur Verfügung gestellt und nur eine einzige Ausnahme gemacht: Von dem „Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen“ (1. Mo 2,17) sollte der Mensch nicht essen.
Wenn Gottes Wort darauf hinweist, dass es samenbringende Nahrung ist, dann macht das klar, dass in der Nahrung, die Gott gibt, der „Kern des Lebens“ steckt. Das, was zur Erhaltung des Lebens dient, enthält selbst die Anlage für neue Frucht, den Samen. Was im Natürlichen gilt, das ist auch im Geistlichen wahr. Das Wort Gottes ist lebendig und ist die perfekte Nahrung für das neue Leben des Gläubigen.
Später hat Gott dem Menschen auch die Tiere der Erde, die Vögel und die Fische zur Nahrung gegeben (s. 3. Mo 11).
Zeitlos gültig
Gott, der Schöpfer, hatte einen genialen Plan. Diesen Plan hat Er umgesetzt und es war sehr gut. Das, was Er in seine Schöpfung hineingelegt hat und die Ordnung, die Er damit verbunden hat, ist zum Segen des Menschen. Deshalb wollen wir die Gedanken Gottes verstehen und auch in unserer Zeit noch umsetzen. Es ist zum eigenen Segen und zur Ehre des Gottes, der alles so gut gemacht hat.
Christian Rosenthal
Einblicke in biblische Häuser (Teil 1)

Es ist erstaunlich, wie oft in der Bibel von Häusern die Rede ist. In 1. Mose 7,1 finden wir die erste Erwähnung: „Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus.“ Hier sind alle gemeint, die zur Großfamilie Noahs gehörten und vielleicht auch unter einem Dach wohnten. In diesem Sinn benutzen wir heute das Wort „Haushalt“.
In der Bibel wird auch von Häusern im buchstäblichen Sinn gesprochen. Im Buch Hiob, einem der ältesten Bücher der Bibel, ist die Rede von Lehmhäusern (s. Hiob 4,19) und auch von Häusern aus Steinen (s. Hiob 15,28). Oft wurden sogar die Tiere mit in diesen Häusern untergebracht. Die Frau in 1. Samuel 28,24 hatte ein gemästetes Kalb im Haus. Auch wohnten die Knechte und Mägde mit in den Häusern ihrer Herren.
Die flachen Dächer der Häuser wurden oft als zusätzlicher Aufenthaltsort benutzt. In Apostelgeschichte 10,9 stieg Petrus auf das Dach, um zu beten. In 2. Samuel 11 ging David auf dem Dach seines Hauses umher und in Markus 2,4 wurde ein Gelähmter auf das Dach gebracht und durch das Dach zu dem Herrn Jesus herabgelassen. In Haggai 1,4 werden getäfelte Häuser erwähnt.
In dieser Artikelreihe wollen wir uns mit einigen Häusern im Sinn von „Haushalten“ beschäftigen. Wir fragen uns, wer dort wohnt, wie die Menschen dort zusammenleben, was sie erleben und nicht zuletzt wie ihre Beziehung zu Gott ist.
Wir dürfen dem Herrn dankbar sein, dass wir alle ein Dach über dem Kopf haben: eine Wohnung oder sogar ein Haus – nicht alle Menschen dieser Erde haben dieses Vorrecht! Aber wir wissen nur zu gut, dass das Äußere allein nicht glücklich macht. Wie sieht es in unseren Wohnungen wirklich aus? Damit meine ich nicht die Dekoration, sondern unser Leben. Da gibt es Freude, aber auch Leid; Gemeinschaft, aber auch Einsamkeit; Frieden, aber auch Streit …
Es kann deshalb sehr lehrreich für uns sein, biblischen Häusern einen Besuch abzustatten. Das erste Beispiel, mit dem wir uns in diesem Artikel beschäftigen möchten, ist Abraham.
Abraham wohnte in Zelten
Zelte kann man aufbauen und wieder abbrechen. Wer in Zelten wohnt, ist nicht sesshaft. In Hebräer 11,9.10 wird gesagt: „Durch Glauben hielt er [das ist Abraham] sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem fremden und wohnte in Zelten, … denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat …“ Für uns lernen wir daraus, dass wir als Gläubige in dieser Welt Fremde sind, deren Heimat im Himmel ist. „Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten“ (Phil 3,20).
Es besteht die Gefahr, dass wir innerlich auf dieser Erde sesshaft werden oder uns sogar mit der Welt anfreunden. Zeigt sich in unserem Leben noch der Fremdlingscharakter und die Erwartung der himmlischen Herrlichkeit? „So sucht, was droben ist, wo der Christus ist … Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist“ (Kol 3,1.2).
Wo Abraham wohnte
Abraham wohnte unter den Terebinthen Mamres, die bei Hebron sind. Terebinthen sind große, Schatten spendende Bäume, die Schutz vor den heißen Sonnenstrahlen bieten und zum Ausruhen einladen. Hebron bedeutet Gemeinschaft und Mamre kann mit Fettigkeit übersetzt werden.
Als Gläubige dürfen wir Gemeinschaft mit Gott haben und in seiner Gegenwart zur Ruhe kommen. Dann können wir den Segen Gottes genießen und Freude daran haben. „Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei“ (1. Joh 1,3.4).
Die gelebte Gemeinschaft mit dem Herrn ist die Grundlage für die Gemeinschaft untereinander. Das gilt ganz besonders auch für unsere Familien.
Abraham baute dem Herrn einen Altar
Der Altar spricht von Anbetung. Kennen wir Anbetung in unserem persönlichen Leben? Auch unsere Häuser sollen Orte sein, an denen angebetet wird, das heißt, wo man die Größe Gottes bestaunt und Ihn dafür preist.
Abraham saß am Eingang des Zeltes
Obwohl Abraham große Kleinviehherden besaß, was viel Arbeit mit sich brachte, kannte er Momente der Ruhe und der Besinnung. Am Eingang des Zeltes konnte er überblicken, wer sein Zelt betrat oder verließ (s. 1. Mo 18,1.2).
Dies appelliert besonders an uns Väter, dass wir darüber wachen, was in unsere Häuser eindringt und wohin seine Bewohner gehen. Bedenken wir dabei auch, dass die Welt heute über die Medien in unsere Häuser hineinkommt, ohne dass wir die Tür aufmachen müssen.
Die Hitze des Tages, bei der er am Eingang seines Zeltes saß, spricht von den besonderen Herausforderungen des Lebens; dann, wenn es „heiß hergeht“. Wenn wir gestresst sind, besteht die Gefahr, dass wir die Dinge schleifen lassen. Lasst uns auch dann besonders wachsam sein, wie Abraham es war – mit der Hilfe des Herrn!
Abraham erkannte die Besucher sofort
Aus einem Leben der Gemeinschaft mit Gott hatte Abraham ein geschultes Auge. Er erkannte den himmlischen Besuch und begegnete Ihm in der gebührenden Weise. Er vermochte zwischen den beiden Engeln und dem Herrn zu unterscheiden (s. 1. Mo 18,3). Der Herr Jesus sagt in Johannes 10,27: „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir.“
Wie sieht es mit unserem geistlichen Unterscheidungsvermögen aus? Der Herr schenke auch uns ein geübtes Auge wie Abraham.
Abraham übte Gastfreundschaft
Er bot Wasser an zur Erfrischung, einen Platz zum Ruhen und Brot zur Stärkung. Dabei dachte er nicht nur an die körperliche Erholung, sondern auch an die innere: „… stärkt euer Herz“ (s. 1. Mo 18,4.5).
Wiederholt werden wir in Gottes Wort zur Gastfreundschaft ermuntert (s. Heb 13,2; 1. Pet 4,9). Wofür sind unsere Häuser bekannt? Wo die Gemeinschaft untereinander gepflegt wird, dient es zur Ermunterung und zum Segen – sowohl der Gäste als auch der Gastgeber.
Abraham sprach mit seiner Frau darüber
Wenn Gäste eingeladen werden, bedeutet dies auch zusätzliche Arbeit, besonders für die Hausfrauen. Wie schön ist es, wenn Ehepaare es gemeinsam auf dem Herzen haben, Gastfreundschaft auszuüben und auch unsere Kinder früh lernen, wie gesegnet es ist, gastfrei zu sein und offene Häuser zu haben.
Abraham packte mit an
Es ist bemerkenswert, wie aktiv er in dieser Szene war. Abraham ließ seine Frau mit der Hausarbeit nicht allein, sondern lief selbst zu den Rindern und suchte das beste Kalb aus. Er holte dicke und süße Milch und am Ende servierte er die Speisen (s. 1. Mo 18,8).
Unsere Frauen werden es wertschätzen, wenn wir als Männer die Arbeit im Haushalt sehen und nach unseren Möglichkeiten mithelfen.
Abraham blieb stehen
Während die himmlischen Gäste aßen, blieb Abraham stehen. Damit drückte er seine ganze Ehrfurcht ihnen gegenüber aus. Unsere Häuser sollten vor allem durch Gottesfurcht geprägt sein. Ihr sollte sich alles andere unterordnen. Dabei ist die Bibel unser Maßstab und die Liebe zu dem Herrn Jesus unsere Motivation.
Andres Kringe
Die Bibel ist unser Maßstab
und die Liebe zu dem Herrn Jesus unsere Motivation.
Bei Gott zu Hause (Psalm 90,1)

Knapp 30 Jahre wohnte die Familie in einem angemieteten Haus. Dort sind die Kinder aufgewachsen. Nachdem alle Kinder das Haus verlassen hatten, zogen die Eltern um. Als eins ihrer Kinder sie in der neuen Bleibe besuchte, sagte es sinngemäß: „Jetzt komme ich zu euch, aber nicht nach Hause.“
Mit „zu Hause“ verband dieses Kind nicht nur die Eltern, sondern auch das Haus, wo sein Kinderzimmer gewesen war, in dem sein Bett gestanden hatte, wo das Esszimmer gewesen war, in dem man die gemeinsamen Mahlzeiten eingenommen hatte, wo der Garten war, in dem es mit seinen Geschwistern gespielt hatte. Das und noch manches mehr gehörte für das Kind zum Zuhause, sicher auch viele Erinnerungen. Und wenn es dort noch Liebe und Geborgenheit erfahren hat, dann war es ein schönes Zuhause gewesen.
Wahrscheinlich gegen Ende der Wüstenreise sagt Mose: „Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht“ (Ps 90,1). David sagt in Psalm 71,3: „Sei mir ein Fels zur Wohnung, zu dem ich stets gehen kann! Du hast geboten, mich zu retten, denn du bist mein Fels und meine Burg.“
Für David war Gott Fels, Wohnung und Burg. Er war die Zufluchtsstätte, wenn seine Feinde ihn bedrängten. Mose, der nur von einer Wohnung spricht, scheint mehr den Gedanken zu haben, dass Gott ein Zuhause ist.
Der Herr Jesus war als Mensch auf der Erde vollkommen bei dem Vater zu Hause. Das ist wohl auch der tiefere Sinn seiner Worte, als Er als Zwölfjähriger zu seinen Eltern sagte: „Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist?“ (Lk 2,49).
Die ersten Jünger fragten den Herrn: „Wo hältst du dich auf?“ „Kommt und seht!“, war seine Antwort (Joh 1,38.39). Wo Er auch war, stets war der Vater gleichsam seine Wohnung. Dadurch lernten die Jünger mehr und mehr den Vater kennen. Und aufgrund der Gespräche des Herrn mit seinem himmlischen Vater äußerten sie die Bitte: „Herr, lehre uns beten …“ (Lk 11,1).
Wenden wir das einmal auf uns als Eltern und auf unsere Kinder an: Wenn wir als Eltern bei Gott zu Hause sind, wenn wir in inniger Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn leben (s. 1. Joh 1,3), wenn unsere Kinder sehen und hören, wie wir vertrauten Gebetsumgang mit dem Vater und dem Sohn pflegen, dann wird das positive Auswirkungen auf sie haben. Sie werden etwas von der Liebe des Vaters und des Sohnes schmecken und wenn sie sich schon bekehrt haben, zu einem persönlichen Gebetsleben angeleitet werden.
Gott ist unsere Wohnung, sind wir bei Ihm zu Hause?
Horst Zielfeld
Ein entmutigter Prophet – Gott richtet auf

Bist du vielleicht niedergeschlagen und entmutigt? Du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll und siehst alles nur noch durch die dunkle Brille. Vielleicht hast du sogar schon resigniert. Dabei machst du dir insgeheim Vorwürfe: Wie kann ich als Kind Gottes nur so sein, wie ich bin? Du meinst: Andere sind fröhlich und bewältigen zuversichtlich ihre Aufgaben. Doch ist das wirklich so?
Ein Bote in böser Zeit
Blenden wir in das Leben und den Dienst des Propheten Jeremia, eines treuen Boten Gottes, der alles andere als immer fröhlich und zuversichtlich war. Dieser feinfühlige Mann Gottes litt unter der Ablehnung seines Volkes und fühlte sich einsam. Er war nicht verheiratet (s. Jer 16,2) und ihm fehlte ein mitfühlendes Herz. Zu Recht wird er „der weinende Prophet“ genannt (s. Jer 13,17; 14,17).
Jeremia hat in jenen Tagen des Niedergangs unter dem Volk Gottes Furchtbares erlebt. Wir wollen uns eine besondere Situation aus seinem Leben nachfolgend anschauen.
Im Auftrag seines Gottes hatte er vor den Ohren des Volkes Gericht ankündigen müssen:
„So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Siehe, ich will über diese Stadt und über alle ihre Städte all das Unglück bringen, das ich über sie geredet habe; denn sie haben ihren Nacken verhärtet, um meine Worte nicht zu hören“ (Jer 19,15).
Es ist nicht zu fassen: Paschchur, der Priester, schlägt ihn daraufhin und legt ihn in den Stock (s. Kap. 20,2).
Als Jeremia am nächsten Tag – treu dem Auftrag Gottes folgend – die Wegführung der Priester mit den Worten ankündigt: „… Und du, Paschchur, und alle Bewohner deines Hauses, ihr werdet in die Gefangenschaft gehen; und du wirst nach Babel kommen und dort sterben und dort begraben werden …“ (V. 6) – folgt ein völliger Zusammenbruch!
Sein Notschrei
Jeremia schreit zu seinem Gott: „Herr, du hast mich beredet, und ich habe mich bereden lassen; du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag, jeder spottet über mich … ich werde müde es auszuhalten, und vermag es nicht“ (V. 7 ff.).
Es ist ein leidenschaftlicher Gefühlsausbruch. Der Spott, die Verhöhnung, das Gelächter des Volkes haben ihn zutiefst verletzt! Zugleich hört er die Verleumdung vieler – das Raunen, das Flüstern hinter seinem Rücken … Er seufzt: Ich kann nicht mehr!
Herr, lass mich nicht beschämt werden, denn ich habe dich angerufen!
Von Freunden verlassen – wirklich?
Jeremia klagt: „Alle meine Freunde lauern auf meinen Fall …“ (V. 10). Alle seine Freunde?
Gab es nicht doch den einen wahren Freund, den Herrn der Heerscharen, der zu aller Zeit liebt und als Bruder für die Bedrängnis geboren wird? (s. Spr 17,17).
Der Herr Jesus ist in Wahrheit der eine [Freund], der liebt und anhänglicher ist als ein Bruder (s. Spr 18,24) – auch wenn du es nicht gleich verspürst. Nichts – weder „Höhe noch Tiefe“ deiner momentanen Gemütsverfassung – kann dich von seiner Liebe scheiden (s. Röm 8,35).
Er hat schon den Ausgang deiner schwierigen Situation im Blick und legt dir als Last „kein Gramm“ mehr auf, als du ertragen kannst (s. 1. Kor 10,13). Dessen darfst du ganz sicher sein!
Jeremia, gestärkt im Glauben …
Der Herr der Heerscharen ermutigt seinen niedergedrückten Knecht: „Aber“, wird ihm aufs Neue bewusst, „der Herr ist mit mir wie ein gewaltiger Held, darum werden meine Verfolger straucheln und nichts vermögen“ (V. 11).
Er erinnert sich an Gottes Zusage zur Zeit seiner Berufung zum Propheten: „Fürchte dich nicht …; denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr“ (Kap. 1,8). War das nicht genug, ihn über alle kommenden Widerwärtigkeiten zu erheben?
Ja – unser Herr ist und bleibt treu! Auf Ihn kannst auch du dich verlassen! Er will auch dich „nicht versäumen und nicht verlassen“. Kühn darfst du sagen: „Der Herr ist mein Helfer, und ich will mich nicht fürchten …“ (s. Heb 13,5.6).
… vertraut seine Rechtssache dem Herrn an
Er betet: „Und du, Herr der Heerscharen, der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herz siehst, … dir habe ich meine Rechtssache anvertraut“ (V. 12).
Mach es genauso! Sag Ihm alles, was dich beschwert. Übergib die ganze Not dem, der gerecht richtet (s. 1. Pet 2,23). Und wenn du die Last bei Ihm abgeladen hast – vertraue Ihm. Das erleichtert Herz und Gemüt.
Jeremia ist auf einmal zum Singen zumute! Er jubelt: „Singt dem Herrn, preist den Herrn! Denn er hat die Seele des Armen errettet aus der Hand der Übeltäter“ (V. 13).
Die Dankbarkeit ist immer noch eine durchaus wirksame Arznei für ein beschwertes Herz, denn Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben! Willst du nicht wenigstens einmal am Tag überlegen, wofür du Gott danken kannst?
Jeremia verflucht den Tag seiner Geburt …
Gerade noch hat er den Herrn gepriesen, dankbar bezeugt, dass Er die „Seele des Armen“ aus der Hand der Übeltäter errettet hat, und dann wird er im nächsten Augenblick gewissermaßen doch seines Lebens müde: „Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde; der Tag, da meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet!“ (V. 14).
Wir wissen nicht, was diesen weiteren „Absturz“ ausgelöst hat.
„Warum“, fragt er, „bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergingen?“ (V. 18).
Warum-Fragen aus einer tiefen Verzweiflung – Gott verurteilt sie nicht.
… und erfährt doch Gottes Langmut
Nun sollten wir meinen, der Herr hätte seinen Propheten aufs Schärfste gerügt, vielleicht mit den Worten: „Reiß dich zusammen – so kann ich dich als meinen Boten nicht mehr gebrauchen …“ Doch nichts von alledem lesen wir!
Welch einen gütigen, verständnisvollen Herrn haben wir doch!
Gott schweigt – und gibt ihm in seiner Gnade einen neuen Auftrag: „Das Wort, das vonseiten des Herrn an Jeremia erging …“ (Kap. 21,1).
Das ist unser Gott, der ewig unveränderlich ist in seiner Liebe und Treue.
Er weiß, dass wir „Staub“ sind (s. Ps 103,14) und erkennt bei all unserem Versagen doch, dass wir Ihn lieben – weil Er uns zuerst geliebt hat! (s. Joh 21,17; 1. Joh 4,19).
Deshalb fasse Mut – und „sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst“ (Kol 4,17). Deine Mühe ist nicht vergeblich im Herrn (s. 1. Kor 15,58). „Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir“ (Off 22,12).
Friedhelm Müller
Harre, meine Seele, harre des Herrn!
Alles Ihm befehle, hilft Er doch so gern.
Wenn alles bricht,
Gott verlässt uns nicht,
größer als der Helfer ist die Not ja nicht.
Ewige Treue! Retter in Not!
Unser Herz erfreue, Du treuer Gott!
Hast du dich heute schon gefreut ?

Eine ungewöhnliche Frage. Und doch berechtigt. Denn Gott möchte, dass wir uns freuen. Aber was ist eigentlich Freude? Ein Blick ins Internet (Wikipedia) sagt uns Folgendes: „Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht.“
Vermutlich würden viele Menschen das so ähnlich sehen. Aber − ist das wirklich Freude im biblischen Sinn? Ich meine: Nein.
- Freude im Sinn der Bibel ist mehr als eine primäre Emotion. Es geht nicht um ein äußerliches „Happy-Gefühl“, sondern um eine tiefe innere Freude unserer Herzen.
- Freude im Sinn der Bibel ist nicht immer die Reaktion auf angenehme Situationen. Das kann so sein, muss aber nicht. Wenn Freude von angenehmen Situationen abhängt, ist sie jedenfalls ziemlich unbeständig.
Echte Freude ist erstens Freude im Herrn, zweitens ist sie im Herzen, drittens kommt sie von Gott und viertens ist sie nicht zwingend an die Umstände gebunden.
David schreibt: „Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als zur Zeit, als es viel Korn und Most gab“ (Ps 4,8). Paulus schreibt den Brief der Freude (den Philipperbrief) nicht aus dem sonnigen Urlaub am Mittelmeer, sondern als Gefangener in Rom. Gerade von dort fordert er zu der tiefsten Freude der Gläubigen auf, zu der Freude im Herrn (s. Phil 4,4). Er selbst hat sogar in schwierigen Umständen diese Freude genossen, die Freude im Herrn oder – wie es im Alten Testament heißt – die Freude an dem Herrn (s. Neh 8,10).
Freude der Welt
Keine Frage: Die Welt hat ihre Freuden zu bieten. Der Teufel weiß genau, dass wir Menschen uns freuen wollen. Und er hat eine ganze Palette an vordergründigen Freuden zu bieten.
Aber Achtung: Die Freude an dem, was die Welt bietet, hat immer das Problem, dass sie nicht echt ist und nicht echt sein kann. Die Freuden der Welt gleichen bunten Luftballons, von denen nichts als eine zerstörte Hülle übrig bleibt, wenn sie platzen. Wir müssen das gar nicht erst ausprobieren. Es ist so. Schon Salomo wusste: „Auch beim Lachen hat das Herz Kummer, und das Ende der Freude ist Traurigkeit“ (Spr 14,13). Oft stehen die Freuden der Welt auch in Verbindung mit dem zeitlichen Genuss der Sünde (s. Heb 11,25). Das Beispiel vom „verlorenen Sohn“ (s. Lk 15) ist hinreichend bekannt. Die schillernden Seifenblasen weltlicher Freuden platzen immer – sei es früher oder später. Das, was unsere „Spaßgesellschaft“ an Freude verspricht, hält sie nicht.
Freude in den Umständen
Gibt es Freude in guten Umständen? Ja, die gibt es. Gott lässt uns schöne Momente erleben und in diesen Umständen dürfen wir uns von Herzen freuen. Aber gute Umstände können sich sehr schnell ändern und dann ist die Freude schnell wieder verschwunden. Auf die Freude in guten Umständen können wir uns jedenfalls nicht verlassen. Der schönste Event-Urlaub ist endlich und die schönste Feier geht vorbei. Wenn Gott uns solche Freude schenkt, sind wir dankbar dafür, aber wir bauen nicht darauf. Sie kann nicht die eigentliche Ursache für unser Glück sein.
Freude am Heil und an den Segnungen Gottes
Eine Freude, die nicht von externen Faktoren abhängig ist, ist zum Beispiel die Freude an der Rettung, die Gott uns geschenkt hat, und an den Segnungen, die Er uns gibt. Doch auch diese Freude ist kein Selbstläufer. Es liegt an uns, ob wir uns mit dieser „großen Errettung“ und den „kostbaren und größten Verheißungen“ (s. Heb 2,3; 2. Pet 1,4) tatsächlich beschäftigen oder nicht. Tun wir es mit aufrichtigem Herzen, so wird sich auch eine tiefe Freude einstellen.
Freude im Herrn
Und dennoch ist die Freude an dem, was unser Herr uns schenkt, noch nicht das Größte. Noch größer ist die Freude im Herrn selbst. Der Geber der Gaben ist größer als die Gaben selbst.
Zu dieser Freude motiviert Paulus uns gleich zweimal: „Freut euch im Herrn“ (Phil 3,1; 4,4). In der zweiten Stelle fügt er noch hinzu: „Wiederum will ich sagen: Freut euch!“ Freude im Herrn ist keine unverbindliche Kann-Option, sondern Gott fordert uns ausdrücklich dazu auf. Diese Freude ist unabhängig von der Situation und unseren Gefühlen. In unserem Herrn können – und sollen – wir uns immer freuen! Allerdings setzt diese Freude die tägliche Gemeinschaft mit unserem Herrn voraus, also den Kontakt mit Ihm beim Lesen der Bibel und im Gebet!
Die Eingangsfrage ist also etwas konkreter zu stellen: Hast du dich heute schon in deinem Herrn gefreut?
Ernst-Augst Bremicker
Freude im Herrn Jesus
macht mich allezeit
glücklich und zufrieden,
selbst in Schmerz und Leid.
Persönliche Worte (Vergiss nicht, zu danken)
Durch die Medien werden wir täglich mit vorwiegend negativen Nachrichten konfrontiert, ja, fast bombardiert. Krisen lösen einander ab oder finden gleichzeitig statt, und manche sind ein Dauerthema: Corona, die Kriege in der Ukraine und im Sudan, die Klimakrise … und, und, und. Das kann schon niederdrücken. Dazu kommen vielleicht noch persönliche Nöte am Arbeitsplatz, Probleme mit der Gesundheit, mit den Kindern … und, und, und. Und als ob das nicht genug wäre, sind da noch die Schwierigkeiten in der Versammlung, örtlich und überörtlich. Wer kann sich da noch freuen?
Aber vielleicht hast du einen sicheren Arbeitsplatz, vielleicht bist du gesund, vielleicht machen dir die Kinder Freude und vielleicht habt ihr Frieden im örtlichen Zusammenkommen. Dafür darfst du dankbar sein. Und vielleicht erkennst du dann, dass es noch viele andere Dinge gibt, für die du dem Herrn Jesus danken kannst. Wir haben Frieden im Land, wir haben Nahrung, Kleidung und Behausung, wir haben Religionsfreiheit … und, und, und. Ja, lasst uns dankbar sein (s. Kol 3,15) und uns von den beunruhigenden Nachrichten nicht den Blick für all das Gute verstellen lassen, das uns der Herr in seiner Güte schenkt.
In diesem Heft sind einige Artikel, die uns Mut machen wollen und auch ein Artikel, der sich mit unserer herrlichen Zukunft beschäftigt. Und diese ist nicht mehr fern. Ja, „jetzt ist unsere Errettung näher, als damals, als wir gläubig wurden“ (Röm 13,11). Darum wollen wir das tun, was August Hermann Franke (1853-1891) in einem bekannten Lied so ausdrückt:
Nun aufwärts froh den Blick gewandt
und vorwärts fest den Schritt!
Wir gehn an unsers Meisters Hand
und unser Herr geht mit.
Horst Zielfeld
