Dies ist ein Test
Wenn die Blicke dich so sehr nach unten ziehen

Der Blick auf die Umstände
Susanne wird mit der Arbeit nicht mehr fertig. Ihr Mann Marcel kommt immer häufiger unzufrieden von der Arbeit nach Hause. Ihre älteste Tochter hat Probleme in der Schule. Und im Wohnzimmer stapelt sich die Bügelwäsche.Ein verständlicher Wunsch
Dass unsere Hilfe nur vom Herrn Jesus kommen kann, hat Susanne schon als kleines Kind von ihren Eltern gehört. Sie haben ihr auch die Liebe zu Gottes Wort ins Herz gepflanzt. Doch schon seit Wochen empfindet sie keine Freude mehr beim Lesen der Bibel. „Wenn wir doch endlich noch einmal ohne Probleme und Zeitnot leben könnten“, seufzt sie. „Nur ein paar Wochen Ruhe, um wieder Kraft tanken zu können. Ja, wenn die Umstände doch noch einmal anders wären.“ Ob sich die Jünger des Herrn Jesus damals auch andere Umstände wünschten, als sie auf dem See Genezareth in Seenot waren? Gegen Windstille und eine ruhige Wasseroberfläche hätten sie wohl bestimmt nichts einzuwenden gehabt. Schließlich waren sie doch mit dem Schiff unterwegs, weil ihr Herr und Meister es ihnen befohlen hatte. Und nun dieser Sturm. Der Wind war ihnen entgegen und das Boot ein Spielball der wogenden Wellen. So etwas kannten die Jünger bereits. Schon einmal waren sie auf dem See Genezareth in Seenot geraten. Bei dieser Gelegenheit war der Herr von Anfang an mit im Boot gewesen, wenn Er auch müde von seinem ununterbrochenen Dienst im hinteren Teil des Bootes schlief. In ihrer Angst, im Sturm umzukommen, hatten sie den Herrn geweckt und staunend miterlebt, wie zwei Worte aus dem Mund des Herrn reichten, um der Not ein Ende zu bereiten. „Schweig, verstumme“, hatte der Herr nur gesagt und Wind und Wellen mussten sofort gehorchen (Mk 4,39). Doch dieses Mal war es anders. Die Jünger waren dem Gebot des Herrn folgend alleine auf dem Weg ans andere Ufer, Er war nicht mit im Boot. Und als der Herr dann in der vierten Nachtwache zu ihnen kam, änderte Er nicht sofort ihre Umstände. Der Sturmwind heulte unvermindert und die Wellen schlugen unentwegt ins Boot. „Seid guten Mutes; ich bin es; fürchtet euch nicht!“ (Mt 14,27), rief der Herr den Jüngern stattdessen zu.Die ermunternde Aufforderung des Herrn
Auch Susanne und Marcel, ja uns allen, ruft der Herr heute so wie damals den Jüngern zu: „Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht!“"Seid guten Mutes, ich bin es; fürchtet euch nicht!"
Sie wollen den ganzen Artikel lesen? Dazu benötigen Sie ein Online-Abo.
Aktuelle Artikel
Du weißt, dass du eine Mama bist, wenn…
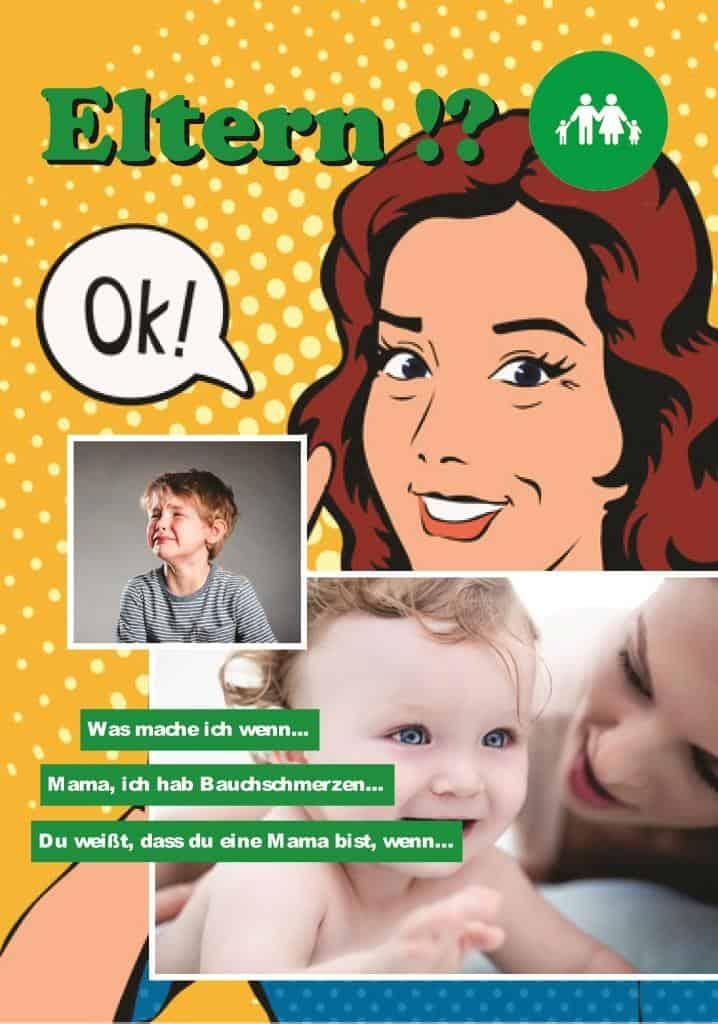
So – oder so ähnlich – könnte es in jeder beliebigen Elternzeitschrift stehen. Doch die Mutter, die versteht, dass ihre Aufgabe an den Kindern Wert für die Ewigkeit hat, sieht es noch ganz anders!
Äußere Teilnahme und innere Gemeinschaft
Äußere Teilnahme bedeutet in Gottes Augen innere Gemeinschaft mit den Grundsätzen, Lehren und Praktiken, die an dem Ort gelten, an dem wir teilnehmen. In unserem Land haben wir es kaum mit Tischen von Dämonen zu tun (wie in Korinth), jedoch durchaus mit „Tischen“, die von Menschen errichtet wurden. Durch das Teilnehmen an diesen „Tischen“ kommt man in Gemeinschaft mit allen Lehren, Grundsätzen und Praktiken, die dort gelten und geduldet werden.
Der Tisch des Herrn – die gemeinsame Verantwortung

Die Segnungen der Gemeinschaft mit Christus, die wir am Tisch des Herrn genießen dürfen, sind nicht losgelöst von unserer Verantwortung. Tatsächlich können wir den Segen am Tisch des Herrn nur dann genießen, wenn wir diesen Platz der Gemeinschaft entsprechend den grundlegenden Voraussetzungen und Gedanken des Wortes Gottes einnehmen. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung dem Herrn gegenüber, an seinem Tisch seinen dort geltenden Rechten zu entsprechen.
In 1. Korinther 10 wird der gemeinschaftliche Aspekt unserer Verantwortung, im Hinblick auf den Tisch des Herrn, betont: „Den Kelch der Segnung, den wir segnen, … Das Brot, das wir brechen, …“ (1. Kor 10,16).
Beim Mahl des Herrn hingegen geht die Tätigkeit zunächst von Christus aus. Er nahm das Brot, und als Er gedankt hatte, brach Er es und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist (s. 1. Kor 11,24.25). So fällt am Tisch des Herrn unserem eigenen verantwortlichen Handeln eine bedeutende Rolle zu.
Der Tisch des Herrn – der Ort der Gemeinschaft

Bereits die ersten Christen kamen am ersten Tag der Woche zusammen, um das Brot zu brechen (s. Apg 20,7). Sie kamen damit auf der einen Seite dem Wunsch des Herrn Jesus nach: „Dies tut zu meinem Gedächtnis“ (Lk 22,19). Indem sie das Brot brachen, gedachten sie des Herrn in seinen tiefen Leiden und seiner Hingabe bis in den Tod. Auf der anderen Seite drückten sie aber auch die Einheit aller Gläubigen auf der Erde aus, die den Leib Christi bilden, dessen verherrlichtes Haupt der Herr Jesus im Himmel ist. Damit bezeugten sie die Gemeinschaft mit dem Herrn und untereinander an seinem Tisch (s. 1. Kor 10,16.17). Sie taten es unter der Leitung des Heiligen Geistes, obwohl sie die Belehrung der Briefe des Neuen Testaments noch nicht besaßen. Diese zweite Seite soll in diesem Artikel etwas beleuchtet werden.
Persönliche Worte (Denkwürdig)
Denkwürdig – was bedeutet das überhaupt? Im Bedeutungswörterbuch findet sich dazu folgende Erklärung: „Von solch einer Art, so bedeutungsvoll, dass man immer wieder daran denken, sich daran erinnern, es nicht vergessen sollte.“
Eine ausweglose Situation – ER kann helfen!

Dem Synagogenvorsteher Jairus war soeben die Nachricht überbracht worden: „Deine Tochter ist gestorben; was bemühst du den Lehrer noch?“ (Mk 5,35). Wir stellen uns vor, wie sehr Jairus diese Worte in seinem Innern erschüttert haben müssen. Sein geliebtes Kind lebt nicht mehr. Er ist sprachlos. War denn sein Glaube umsonst gewesen?
Er hatte sich doch auf den Weg gemacht zu dem Herrn Jesus, dem zwar die religiösen Führer des Volkes so viel Verachtung entgegengebrachten, Ihn ablehnten, aber der sich doch „wohltuend und heilend“ in Liebe über Menschen erbarmte (s. Apg 10,38). Das hatte Jairus beobachtet und sich zu dem Herrn Jesus gewandt in dem Glauben: «Er kann auch meine Tochter heilen.»
Zu den Füßen des Herrn Jesus niederfallend, hatte er seine ganze Not vor Ihm ausgesprochen: „Mein Töchterchen liegt im Sterben; komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet werde und lebe“ (Mk 5,23). Und der Herr Jesus hatte sich sogleich auf den Weg gemacht: „Und er ging mit ihm…“ (Mk 5,24).
